Intro
Meine Tochter stellt oft solche Fragen. Meine ältere Tochter (19) stellte seltener solche Fragen. Aber sie schaute gerne den Club mit mir. Zu dieser Zeit moderierte Christine Maier die Sendung. Die Arena schaute sie, als Sonja Hasler moderierte. Von Männern moderierte Talksendungen schaute sie nicht.
Warum die Medien?
Sexismus ist allgegenwärtig. Warum konzentriere ich mich auf die Medien? Die Medien haben einen starken Einfluss auf die Wahrnehmung einer Bevölkerung und was sie kümmert, ihr Angst macht, sie überrascht und was sie prägt. Medien informieren, bilden und bestärken gewisse Bilder und Strukturen und setzen die Themen, über die die Menschen sprechen.
Im Verlauf meiner Recherche, also innert rund drei Jahren, hat sich viel getan. Sexismus ist in unterschiedlichen Facetten präsent in den Medien.
Eine Entwicklung, die sich seit einigen Jahren abzeichnet, hat sich im Verlaufe meiner Recherche noch akzentuiert. Das hat auch damit zu tun, dass Medien Bewegungen wie #metoo aufgenommen und häufig auch ernst genommen haben. Noch vor wenigen Jahren habe ich erlebt, wie hämisch gelacht wurde, als der Redaktionsleiter in einer Kritik sagte, es sei nicht mehr zeitgemäss, das Frauenfussball-WM-Final in der Sendung nicht zu erwähnen. Ich erlebte, wie ein Produzent, also der, der entscheidet was und wie an diesem Tag in die Sendung kommt, sagte, die Newslage sei flau. «Wer also eine Idee hat: Ich habe noch ein paar Minuten Sendezeit zu vergeben.» Ich machte ihn auf die neusten Zahlen zur Lohngleichheit aufmerksam. Er: «Ja, komm! Es ist doch jedes Jahr dasselbe Spiel. Frauen behaupten, sie würden weniger verdienen und die anderen sagen, dies sei nicht so. Was gibt es da zu berichten?» Heute wird nicht mehr darüber diskutiert, ob darüber berichtet wird. Heute diskutiert man wie, mit wem und wie lange man darüber berichtet.
Die Ursachen und die Mechanismen dahinter interessierten mich.
Brisantes Thema
Meine Recherche begann bei mir selbst. Ich arbeite seit rund 20 Jahren in der Medienbranche. In dieser Zeit habe ich viele schockierende Aussagen gehört, unverständliche Entscheide erlebt und viele strukturelle Gründe gefunden, die den Sexismus in den Medien fördern und andere, die ihn nicht verhindern.
Beim Mittagsessen, Café trinken und Rauchen habe ich immer wieder mit anderen über Sexismus gesprochen. Viele Frauen und wenige Männer mit denen ich geplaudert habe, sind der Ansicht, dass Sexismus auch in den Medien stattfindet und problematisch ist. Ich dachte: Super! Ich kann aus dem Vollen schöpfen. ProtagonistInnen gibt es en masse, das Thema ist relevant, polarisiert und es gibt Lösungen. Falsch. Die meisten konkreten Gespräche endeten mit dem Satz: «Aber gäll, zu zitiersch mich nööd». Die wenigen, die zusagten, sagten wieder ab, als es konkret wurde. Andere antworteten nicht mehr auf Anrufe oder Emails. Und dann gab es die, die dann irgendwie keinen freien Termin finden konnten.
Ich wusste nicht mehr weiter. Es blieb mir nichts anderes übrig, als meinen Abschluss am MAZ um ein Jahr zu verschieben. Das Thema wechseln; das wollte ich auf keinen Fall. Jetzt erst recht nicht.
Von rund 50 Personen, mit denen ich die letzten 3 Jahre gesprochen habe, fand ich ein paar Frauen, die ihre Erlebnisse nur anonymisiert schildern wollten. Die Beweggründe, auch für die Absagen, sind zwar verschieden, aber der Kern ist immer derselbe: Angst vor den anderen.
Andere Aussagen kann ich nicht verwenden. Denn ich müsste Situationen oder den Werdegang der Betroffenen so beschreiben, dass für viele sofort klar wäre, um wen es sich handelt.
Von Anfang an dabei ist Thomas Schäppi.
Thomas Schäppi, ein gutes Beispiel
Mitglied Chefredaktion SRF
Thomas Schäppi
Schäppi ist 62 Jahre alt und ist mit einen Bruder und einer Schwester aufgewachsen. Sein Vater war berufstätig und seine Mutter ist, als er ca. 12-jährig war, einer bezahlten Arbeit nachgegangen.
Schäppi ist Vater von zwei Kindern. Seine Frau habe immer gearbeitet. «Das war ein bewusster Entscheid. Sie arbeitete immer 70 bis 80 Prozent»
«Das Bewusstsein der Nach-68er, dass es keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern geben soll, hat mich geprägt. Für mich war das immer einleuchtend. Nicht zuletzt auch wegen dem Beispiel meiner Mutter.»
Thomas Schäppi ist mit einer Schwester und einem Bruder aufgewachsen.

Ich stelle fest: Eine Redaktion mit «familienfreundlichen» Strukturen, hat keine Probleme Frauen zu finden.
Erstaunlich. Denn heute gibt es ja den «neuen progressiven Mann». Wie sieht das denn konkret aus, wenn der progressive Mann und die moderne Frau am Redaktionstisch sitzen?
Geht es um Beiträge über Kinder, Schule, Krippen, Alter, und ähnliche Sozialthemen, werden diese oft an Frauen vergeben. Die Journalistin Seraina Kobler schreibt in einem ihren Posts: « (…) Ich durfte, gerade in meiner Anfangszeit, als fast einzige Frau im Ressort oft „noch etwas für den Mix“ schreiben. Volksschule, Vereinbarkeit. Solche Sachen. Damit man noch ein Kind abbilden kann, oder ein Tier.»
Seraina Kobler
Auswirkungen auf die Berichterstattung
Auch wenn Frauen über andere Themen kompetent, differenziert und kritisch berichten können; bleiben wir mal bei sogenannten frauenspezifischen Themen: Hier spielt die Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung nämlich eine grosse Rolle.
Ein Küchengerätehersteller behauptet «Die Männer erobern die Küche». Eine PR-Aktion, die von einigen Männern als Realität empfunden wird – obwohl die Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigen, dass es bis zur Eroberung der Küche noch ein weiter Weg ist.
Einige Redaktionsmitglieder und ich (damals Regisseur) diskutierten den Beitrag. Ich fragte, wer hier am Redaktionstisch denn Zuhause koche. Männer meldeten sich mit angepisstem Ton und meinten: «Also ich koche oft Zuhause!» Ich hakte nach und fragte, wie oft sie denn kochen würden. «Sicher zwei Mal die Woche. Also am Wochenende bin ich der, der Zuhause kocht.» Ich streckte sieben Fingen hoch und klappte zwei wieder runter. «Und wer kocht die anderen fünf Tage? Wer putzt die Küche? Du gehst doch am Wochenende gerne ins Restaurant und im Sommer grillierst du gerne. Wie oft stehst du tatsächlich in der Küche?» Der Produzent oder Themenkoordinator fand diese Unterhaltung müssig und beendete die Diskussion mit: «Ist jetzt egal.»
Der Beitrag hatte keinen Platz mehr in der Sendung oder war noch nicht fertig. Ich kann mich nicht genau erinnern. Aber er wurde nicht an diesem Tag gesendet.
An dem Tag, an dem der Beitrag gespielt wurde, war eine Produzentin an der Reihe. Sie schaute sich den Beitrag an und sagte: «Diesen Beitrag spiele ich so nicht. Das ist eine PR-Aktion eines Küchengeräteherstellers und entspricht nicht der Realität. Totaler Quatsch ist das.» Und sie begründete ihre Haltung damit, dass Männer ihre Arbeit im Haushalt überschätzen würden. Der Beitrag wurde umgeschnitten, umgetextet und die Moderatorin bekam von der Produzentin den Auftrag, die Moderation umzuschreiben.
«Die Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung der Männer und der Sicht der Frauen auf ihre Männer ist gross.» Sagt eine Redaktorin in einem anderen Zusammenhang.
«Die Berichterstattung sollte ein Abbild der Realität sein. Realität ist aber subjektiv. Sind mehrheitlich Männer in einer Redaktion, entstehen Beiträge (zum Beispiel Familienthemen), die nicht der Realität entsprechen. Durch diese Darstellung in den Medien, werden wiederum andere Männer in ihrer Wahrnehmung gestärkt, sie würden 50 Prozent der Hausarbeit, der Kinderbetreuung usw. erledigen. So entsteht die Illusion des modernen, progressiven Mannes als Massenphänomen.»
Nicht die Schuld der Frauen
Eine Frau, die den Spiess umgedreht hat, ist Andrea Bleicher. Ihre Kinder leben beim Vater in Deutschland. Sie hat es bis zur Chefredaktorin des «Blick» geschafft. Als erste Frau. Ad Interim. Sechs Monate lang.
Erfolgreiche Journalistin
Andrea Bleicher
1974 geboren, wächst sie mit drei älteren Schwestern auf. Ihr Vater war Gewerkschaftssekretär, ihre Mutter war zu Hause.
«Unsere Eltern haben uns immer vermittelt, dass wir alles können und dürfen. Dieses “Mädchen sind so und so” gab es bei uns nie.»
Ihr Lebenslauf ist beeindruckend.
1997 – 1998 Ringier Journalistenschule, danach Reporterin «Blick»
2000 Reporterin und Blattmacherin «20 Minuten» und «Metropol»
2002 Inlandredaktorin «Sonntagszeitung»
2007 Nachrichtenchefin «Blick»
2010 Ressortleiterin News «Blick-Gruppe»
2013 Chefredaktorin «Blick» ad interim.
2014 Stellvertretende Chefredaktorin «Sonntageszeitung»
Seit 2018 Panda und Pinguin

Wie schon Thomas Schäppi ist auch Andrea Bleicher der Ansicht, dass es nicht zwingend die Schuld der Frauen ist, wenn hauptsächlich Männer Karriere machen. Das berichten mehrere Frauen. Eine sagte: «Ich dachte, man macht Karriere indem man gute Arbeit abliefert. Aber so ist es nicht.»
Frau A ist Journalistin und arbeitete hauptsächlich auf Zeitungsredaktionen. Ihr Mann arbeitete auf einer Fernsehredaktion. Sie möchte anonym bleiben.
«Ich führte mit meinem damaligen Mann die absurde Diskussion, warum ich unser Kind ins Bett bringen müsse. Er meinte stets, er muss ja wohl noch die Sendung nachbesprechen. Er war ganz gewöhnlicher Redaktor. Niemand zwang ihn dazu. Und es war auch keine Arbeitszeit. Die meisten Frauen, die ich kenne, egal in welcher Branche, in welchem Unternehmen und auf welcher Stufe sie arbeiten: Sie sind für die Kinder zuständig. Viele Männer networken nach der Arbeit, statt heim zu gehen. Bei uns bleiben die Männer auf den Redaktionen, gehen zusammen Velofahren, Joggen oder etwas trinken und machen die inoffizielle Sendekritik, Blattkritik oder müssen sonstige Dinge besprechen. Am nächsten Tag geht natürlich der Rädelsführer zum Produzenten, Blattmacher, Chefredaktor, Redaktionsleiter oder zu sonst einem Würdenträger des Hauses und verkündet das, was die Herren am Abend zuvor, am Wochenende oder am Morgen im Café diskutiert haben. Kaum kommt der Rädelsführer aus dem Büro des Chefs, schleicht sich der nächste in dasselbe Büro. Einer von denen, der sich in Stellung bringen will. Ob er dann über den Artikel des Rädelsführers ablästert, das weiss ich nicht. Vielleicht wiederholt er einfach, was der andere schon gesagt hat. Einfach nur um sich auch zu profilieren. Die offizielle Blattkritik oder Sendekritik wird mit kollektivem Kopfnicken bestätigt. Also die Männer nicken. Die Frauen gestikulieren viel weniger in solchen Situationen. Das Kopfnicken hat so etwas „territoriales“. Wie wenn Hunde markieren. Ich kann es nicht genau sagen. Es stinkt einfach nach Testosteron.
Im Anschluss ergänzen die Herren noch, was der Chef nicht gesagt hat oder sagen „Wie ich dir vorher schon gesagt habe…“ und zeigen auf den Chef und wiederholen, was der Chef schon gesagt hat. Das ist so richtig übel: Einfach noch allen zeigen: Ich habe es unserem Chef gesagt und er ist gleicher Meinung wie ich. Er nimmt es in die Kritik auf. Also bin ich so etwas wie ein Chef. Ich bin gut; besser als andere hier.
Das ist so widerlich. Aber es funktioniert in der Regel.»
Der Kollege, mein Kumpel
Die Konsequenz dieser Gruppenbildung ist, dass manchmal die Distanz fehlt – der Chef plötzlich Kumpel ist. Folgendes Beispiel ist kein Einzelfall. Solche Situationen habe ich mehrfach erlebt. Ich bekam das gut mit, da ich während rund zehn Jahren gegenüber des Produzenten, also dem Entscheidungsträger sass. In verschiedenen Redaktionen.
Eine Redaktorin geht zum Produzenten. Sie hat eine Agenturmeldung in der Hand. Sie argumentiert, warum dieses Thema in die Sendung müsse. Der Produzent lehnt ab. Die Sendung sei übervoll, das Thema nicht genügend relevant und das Personal knapp. Die Frau insistiert noch ein kleines bisschen und gibt sich geschlagen. Zehn Minuten später kommt ein Redaktor zum Produzenten. Er hat die gleiche Agenturmeldung in der Hand. Die Körperhaltung ist eine ganz andere. Da begegnen sich zwei Macker, zwei Kumpels. «Hey lueg mal!» Keine Argumentation nötig. Der Produzent hat plötzlich Platz in der Sendung, die Geschichte ist relevant und: «Ja! Ist doch eine coole Geschichte. Machst du mir eine Minute oder 50 Sekunden – schön rund erzählt». Früher fragte ich mich, wie man sich wohl als Frau fühlen müsse. Später fragte ich mich, wie man sich als Produzent fühlt. Noch später fragte ich mich, ob der Produzent es überhaupt geschnallt hat. In den letzten Jahren machte ich manche auf ihr Verhalten aufmerksam.
Es gibt sie nämlich, die Sexisten, die sich nicht als solche sehen. Darum ändern sie ihr Verhalten wenn man ihnen seine Beobachtungen schildert. Sie erschrecken und sind über sich selbst erstaunt. Manchmal ist es aber besser, die Frauen sprechen das Thema selber an. Eine Kollegin fragte mich zum Beispiel: «Sehe ich das jetzt total verkehrt oder sagt er mir den ganzen Tag, was ich zu tun habe? Das tut er doch bei Männern nicht – oder?» Sie sprach den betreffenden Produzenten an. Der Produzent änderte sein Verhalten. Auch gegenüber anderen Frauen. Bei ähnlichen Erlebnissen reagierten die Männer mehrheitlich so. Andere, aber wenige, meinten einfach, die sei jetzt halt zickig drauf.
Beispiel Frankreich
In Frankreich erlebte ich eine andere Kultur. Ich hatte das Gefühl, Frauen werden ernster genommen als in der Schweiz. Ich bin französisch aufgewachsen. Ich sah während meiner Kindheit Frauen wie Anne Sinclair und andere Journalistinnen, die Polittalks führten und nicht nur Unterhaltungssendungen.
Es waren zwar mehr Männer am Bildschirm und in Spiel-Shows waren es Frauen, die im Minirock Buchstaben umdrehten – nicht Männer in Badehosen. Aber Frauen hatten in Frankreich nicht nur die Rolle der Schönen, sondern eben auch die der analysierenden Journalistin.
Später, als ich mich durch Deutschschweizer Medien informierte, war ich entsetzt über die Frauenvertretung. Egal ob als Interviewpartnerin oder Interviewerin.
Michael Gerber war von 2011 bis 2017 Frankreich-Korrespondent des SRF. In seinen Beiträgen tauchten überdurchschnittlich viele Frauen auf. Das sei kein Zufall, sagt er:
Ex-Frankreich-Korrespondent SRF
Michael Gerber
Michael Gerber ist 1970 geboren und mit drei älteren Schwestern und vier Brüdern, als Zweitjüngster auf einem Bio-Bauernhof aufgewachsen. Warum starke Frauen für ihn das Normalste der Welt ist, erklärt er hier: Video ansehen
Michael Gerber arbeitet wieder in Zürich beim SRF. In seiner neuen Rolle als Koordinator für die AuslandkorrespondentInnen, wird er den AutorInnen nicht sagen, sie müssten in ihren Beiträgen mehr Frauen zu Wort kommen lassen. «Aber ich werde regelmässig sagen, dass ich es gut fände».

Reflexe
Also ist das Problem, bzw. die Lösung, in den Köpfen? Muss man Parität erzwingen und warten, bis sich in den Köpfen der Leute das ganze normalisiert hat?
Momentan sieht es aber noch düster aus. Bewerbungsgespräche zeigen, dass nicht nur Männer gefestigte reaktionäre Bilder und Rollenmodelle im Kopf haben. Mir wurde auch von HR-Frauen berichtet, die Frauen beinahe ausschliesslich persönlich-emotionale Fragen stellten, während sie Männer mit vorwiegend sachlich-beruflichen Fragen konfrontierten.
Frau B ist Journalistin. Sie hat viele Jahre im gleichen Unternehmen gearbeitet. Sie wird von ArbeitskollegInnen sehr geschätzt und gilt als professionelle und hervorragende Journalistin. Sie will nicht erkannt werden.
Ich kam aus dem Bewerbungsgespräch und fühlte mich, als hätte ich zehn Kinder. Als wäre ich die vielen Jahre, die ich in diesem Unternehmen gearbeitet habe, ständig abwesend gewesen um meine Kinder zu versorgen. Ich fragte mich, ob ich all die Jahre nicht bewiesen habe, dass ich meine Familie sehr gut managen kann. Und weisst du, es war eine HR-Frau.
Frau C ist Mitte 30 und arbeitet seit rund zehn Jahren als Zeitungs- und Fernsehjournalistin. Ihr Partner ist verwitwet und hat 2 Kinder. Er kann sich seine Arbeit einteilen.
Ich war gut vorbereitet. Ich ging in das Bewerbungsgespräch und wusste: Egal welche Frage kommt, ich habe eine gute Antwort. Die erste Frage hat mich aber total aus der Bahn geworfen. Danach war ich verunsichert und abgelenkt. Ich musste immer wieder an der ersten Frage rumstudieren.
Die Frage:
In deiner Beziehung hat es Kinder. Es sind zwar nicht deine aber dein Partner muss ja arbeiten: Wie organisierst du das?
Frau D ist Journalistin. Ihr Mann hat einen normalen Bürojob und kann um 15 Uhr das Büro verlassen. Via Homeoffice erledigt er den Rest seiner Arbeit. Frau D bewarb sich auf einen Führungsposten. Diese Fragen stellte eine HR-Frau.
Es folgt ein Gedächtnisprotokoll aus der Sicht von Frau D erzählt.
Deine Kinder sind 13 und 15. Sind sie schon selbstständig genug?
Für was?
Du kommst ja nicht sehr früh nach Hause.
Ich bin verheiratet und wir leben zusammen.
Ah, ja klar. Deine Kinder sind also selbstständig genug? Es sind nicht alle in diesem Alter selbstständig. Du warst ja die letzten Jahre nicht oft abends zu Hause.
Was meinst du damit?
Nichts. Ich habe die Antwort, die ich brauche. Wir wollen einfach nicht, dass du diesen Schritt bereust. Zufriedene Angestellte sind uns wichtig. Wir müssen sicherstellen, dass es dir auch privat gut geht und du dich nicht überforderst.
Es ist ein Reflex. Wir sehen überall Klischees. Die Werbung ist voll davon, unsere Eltern, Grosseltern, Geschichtsbücher, Filme und die Medien: Überall werden wir an konservative Familienbilder erinnert. Und daraus resultiert, dass wir reflexartig Männern im Berufsleben mehr zutrauen als Frauen.
Perspektiven
In den Medien ist vieles schlecht messbar und somit im Geschmacksbereich. Daher spielen Sympathien eine Rolle. In den Redaktionen entstehen diese oft eben beim gemeinsamen Biertrinken, Joggen oder Skiwochenende. Weniger am Caféautomaten oder im Lift. Schon gar nicht am Redaktionstisch. Denn am Redaktionstisch ist es zu spät. Das behaupten viele Frauen, mit denen ich gesprochen habe. Eine, die ebenfalls anonym bleiben möchte, beschreibt es so:
«Es gibt die Stufen, die erreichst du mit Fleiss und genauer Arbeit. Aber wir Frauen, wir müssen immer besser sein als die männlichen Konkurrenten. Bei Frauen heisst es „Fehler“, „eine Ungenauigkeit“ oder „eine Schwäche“. Bei Männern heisst es „Versehen“, „eine Unschärfe“ oder „hatte einen schlechten Tag“. Wir sind „zickig“, „karrieregeil“ oder „intrigieren“. Männer sind „bestimmt“, „auf den kann man zählen“ oder „er hat einen wichtigen Hinweis geliefert“.
Ab einer gewissen Stufe kommst du nur noch weiter, wenn du mit dem Chef Tennis spielst, ins Skiwochenende fährst oder Bier saufen gehst. Und auch wenn eine Frau es wollen würde; sie wäre nicht willkommen. Denn Männer unternehmen lieber solche Dinge mit anderen Männern. Es geht nicht mal darum, dass sie gerne über Frauen lästern, über Brüste reden, ins Puff gehen oder irgendwas in der Art: Sie fühlen sich einfach gehemmt wenn Frauen dabei sind.»
Männer bestätigen mir, einer formuliert es so: «Es ist nicht das selbe, wenn eine Frau dabei ist. Da steht man irgendwie immer auf der Bremse. Ohne bestimmten Grund. Es ist einfach so.»
Frau E ist eine Frau, die beruflich einiges erreicht hat. Sie sagt, sie hätte einfach Glück gehabt.
«Ohne Seilschaften hast du es als Frau extrem schwer über eine gewisse Hierarchiestufe zu kommen. Ich glaube, Frauen sind anders sozialisiert. Freundschaften halten vielleicht länger oder sie interessieren sich auch für Menschen, mit denen sie nicht arbeiten. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass Journalistinnen einen Freundeskreis haben, der nicht nur aus JournalistInnen besteht. Journalisten scheinen ihre Freizeit mehrheitlich mit Journalisten zu verbringen. Arbeitskollege ist dann schnell mal Freund. Und Freund ist am Redaktionstisch nicht nur Journalist sondern vor allem Freund.
In diesem Klima ist es als Frau nicht einfach, täglich am Redaktionstisch zu bestehen. Manchmal will man nicht kämpfen. Nicht noch das, denk man sich und lässt die Spiele der Silberrücken über sich ergehen.»
Das Spiele des Umweges
Spiele. Das ist etwas, was ich von Frauen wenig erlebt habe. Mein subjektiver Eindruck ist, dass sie ihre Anliegen mit Argumenten untermauern. Sie versuchen es auf der sachlichen Ebene. Männer wählen gerne Umwege und Spiele um ihr Ziel zu erreichen.
Frau F arbeitet nicht mehr als Journalistin. «Jetzt arbeite ich in einer klassischen Frauen-Branche. Das ist viel angenehmer.» Früher arbeitete sie auf einer Fernsehredaktion.
«Es ging darum, wer neue Produzentin oder neuer Produzent wird. Es wurden am Tisch nur Männernamen aufgezählt. Nach einigen Minuten warf ich drei Frauennamen in die Runde. Stille. Alle arbeiteten weiter. Ohne ein Wort über meine Vorschläge zu verlieren. Zwei Tage später ging es wieder los. Es waren zum Teil andere Männer dabei. Und plötzlich verstand ich das Spiel: Die Männer nannten einen Namen, eines männlichen Kollegen natürlich, und dann wurde kurz andiskutiert, warum derjenige nicht der richtige wäre. Und dann sagte einer „Aber du wärst doch ein guter Kandidat“. Das Ziel war also nur, sich von den anderen die Bestätigung für sich selbst einzuholen. Mit dieser Taktik brachte man sich also selbst ins Spiel, ohne dass man sich selbst hätte erwähnen müssen. Und wer wusste, dass er selbst kein valabler Kandidat war, betonte sehr, wie cool er es fände, wenn einer der anwesenden Silberrücken Produzent wird. Die, die schon Produzenten waren, sagten manchmal: „Ich sage es dem Chef: Du und du, ihr wärt gute Produzenten.“ Somit sicherte er sich für einige Wochen die Loyalität der beiden.
Es hat eine Weile gedauert, aber ich habe dann das Spiel verstanden. Und es war jedes Mal so. Jedes Mal.»
Spiele sind auch in der inoffiziellen Nachbesprechung an der Tagesordnung. Und sie sind durchschaubar. Und laufen, in den verschiedenen Redaktion, nach dem gleichen Muster ab.
Frau G ist Journalistin, Ende 20 und hat für verschiedene Medien gearbeitet.
«Ich habe keine Kinder. Ich blieb nach den Sendungen. Lang hielt ich das nicht aus. Die Männer, die blieben, schmierten sich gegenseitig Honig ums Maul. Es begann mit Kleinstkritik am eigenen Werk. Diese Art von Kritik, weisst du, so leicht negativ, die die anderen aber super einfach entschuldigen können. Manchmal kam die Entschuldigung sogar vom Autor selbst. „Ich habe da unsauber getextet. Aber ja, der Produzent hat den ganzen Beitrag umgebaut – ihr wisst wie er ist, gäll – irgendwann hatte ich keine Zeit mehr.“
Und dann wurden die anderen Beiträge diskutiert. Die von denen, die nicht anwesend waren. Meistens eben die der Frauen. Da war die Kritik richtig hart. Und es wurde sehr oft persönlich. Sie diskutieren über den Beitrag einer Frau und da fängt einer an: „Hast du gesehen? Die war heute wieder zickig drauf. Den ganzen Tag hatte sie Kopfhörer auf und starrte in den Bildschirm, hörte nichts und niemanden, stampfte durch die Gänge – nicht mal die Mittagpause hat sie mit uns gemacht.“ Legt ein Mann ein solches Verhalten an den Tag heisst es: „Puh, er hatte viel zu tun heute. Hunderte O-Töne durchhören – nicht einmal Zeit für eine Mittagspause.“
Männer – in der gesamten Arbeitswelt – tun dies. Es ist klar wo das hinführt: Die Beiträge der Frauen schneiden schlechter ab. Denn sie sind nicht anwesend um Gegensteuer zu geben. Wenn ich den Beitrag einer Kollegin verteidigte, wurde mir oft zwar Recht gegeben, um dann aber auf die grundsätzlichen Mängel an ihrer Arbeit aufmerksam zu machen. Sie müsse immer so früh weg und deswegen seien ihre Beiträge oft am Ende schludrig. Auch wenn die Beiträge oder Artikel der Frauen in der offiziellen Kritik nicht negativ erwähnt wurden, blieb in der Wahrnehmung, also in den Köpfen vieler Männer, mehr Negatives hängen.
Irgendwann hatte ich keine Lust mehr auf diese fakultativen Nachbesprechungen. Dafür war mir meine kostbare Freizeit zu schade. Es lief immer auf das gleiche hinaus. Die Männer bildeten ihr Rudel, die Frauen wurden gejagt. Auch Sprüche über Kleidung, Brustumfang, Beine oder Arsch von Kolleginnen musste ich mir anhören. Verdammt! Ich sass daneben! Und es wurde über die Grösse der Brüste meiner – also unserer – Kollegin diskutiert. Schau mich an: Ich habe Körbchengrösse unternull. Und neben mir wird über eine meiner Kolleginnen gesagt: „Nein wirklich. Da könnte ich nicht. Ich bin doch nicht schwul, hey.“ Fick dich! Dachte ich. Aber gesagt habe ich nichts. Ich fühlte mich, als wäre ich nicht anwesend. Ich hatte keine Lust mehr nach der Arbeit noch über gute Ideen, Fehler und Brüste zu diskutieren. Ich diskutierte sowieso immer weniger mit. Passive Anwesenheit. Gute Ideen füllten eh höchstens zehn Prozent dieser unbezahlten Überstunden, die sowieso niemand verlangt.
Man kann sagen, es sei mein Fehler. Ich hätte etwas sagen können. Es hätte nichts geändert. Doch: Die Wölfe hätten mich nicht mehr als Reh gesehen und gejagt, sie hätten mich als… Wölfe haben keinen natürlichen Feind. Die Metapher geht nicht auf. Aber siehst du: Der Wolf steht zuoberst in der Nahrungskette. Andere Wölfe, Krankheiten und die Walliser Jäger sind seine Feinde. Das passt.»
Wie bewertet Mann Frau?
Innerhalb der Redaktion werden aber nicht nur Journalistinnen anders bewertet, sondern auch Protagonistinnen.
An der Redaktionssitzung werden die Themen verteilt. Zudem erzählt der Autor oder die Produzentin, was der Beitrag erzählen und wer darin vorkommen soll. Wenn noch nicht klar ist, wer zum Thema etwas sagen kann, oder was die interessanten Aspekte einer Geschichte sind, geben die RedaktorInnen Inputs. Meistens sucht man ExpertInnen oder Betroffene. Eines Tages wurde eine ExpertIn gesucht zum Thema Machtverteilung, demokratische Abläufe einzelner EU-Staaten innerhalb der EU (Ich weiss nicht mehr genau, was der Plot der Geschichte war). Das ist eines der Kerngebiete von Regula Stämpfli. Dennoch konnte ich ihren Namen nicht zu Ende aussprechen. «Nein! Die geht gar nicht! Die ist ein Unguided missile». Roger Köppel hingegen fand man eine sehr gute Wahl. «Er polarisiert und ich meine, sorry: Aber der ist ja sowas von eloquent und eine richtige Argumentationskanone.» Ich argumentierte, dass Stämpfli aufgrund ihres Werdegangs für dieses Thema kompetent sei. Ausserdem sei sie Expertin in Sachen Demokratie, dass sie auch in Brüssel arbeite und, und und. Keine Chance. Auch bei anderen Geschichten: Es wurde immer gegen Regula Stämpfli argumentiert und entschieden. Hingegen gab es eine Zeit, da befragte man Roger Köppel im Wochentakt zu X-beliebigen Themen. Ist es nicht so, dass Regula Stämpfli polarisiert? Ist sie nicht eloquent? Und ist sie nicht eine echte Argumentationskanone? Einige Male sagte ich: «Hätte Regula Stämpfli einen Schwanz, wäre sie dauernd auf dem Sender». Davon bin noch heute überzeugt.
Frauen haben ihre Rolle zu spielen. Auf den Redaktionen, in der Öffentlichkeit und Zuhause. Aufmüpfigkeit und Bohren wo es weh tut, gehören nicht zu dieser Rolle. Und schon gar nicht zwischendurch den Sexismus ansprechen – und sowieso nicht in anklagendem Ton.
Männer dürfen hingegen gerne mal laut, unreflektiert – der Provokation willen – über das Ziel hinausschiessen. «Ja, das tut der Berichterstattung gut», sagte mir ein Produzent.
Es gibt sie, die Frauen, die sich verteidigen, die für ihr Recht, für Respekt und ihre Meinung kämpfen. Aber in manchen Fällen werden sie eben als Frau beurteilt und müssen sich ruhiger verhalten, als sie es tun, sagen Frau H und Frau I. Beide haben für Radio und Zeitungen gearbeitet. Beide sind rund 30.
Es folgen Gedächtnisprotokolle von Bewerbungsgesprächen aus der Sicht von Frau H und Frau I erzählt.
Frau H:
Du hast gesagt, du interessierst dich für diesen Posten. Wir nehmen alle Bewerbungen ernst.
Was heisst das?
Dass wir dich eigeladen haben und dir ein paar Fragen stellen. (…) Glaubst du nicht, du bist zu jung für diesen Posten?
Der Jetzige ist sieben Tage jünger als ich.
Ist er?
Ja, ist er!
Er hat eine natürliche Autorität. Du wirkst halt noch sehr jung.
Ich bin dafür sehr themensicher, hervorragend informiert, habe einen besseren Leistungsnachweis, bin länger im Journalismus, habe auf mehr Redaktionen gearbeitet als er und bin schon länger hier. Willst du das Gegenteil beweisen?
Nein, wenn du das sagst… ich kann das jetzt so auf die Schnelle nicht alles überprüfen. Ich glaube es dir.
Siehst du: Ich habe, trotz meiner Jungend, eine natürliche Autorität.
Ich habe den Posten nicht bekommen. Er wurde einem Mann vergeben, der ein Jahr älter ist und ein paar Jahre weniger journalistische Erfahrung nachweisen kann.
Frau I:
Was sind deine Pläne? Privat?
Pfff, öööm, das weiss ich gerade nicht so. Momentan steht das nicht im Vordergrund.
Wann rückt das Private in den Vordergrund?
Weiss nicht. Wenn ich Zeit dafür habe, vielleicht. Irgendwie… Keine Ahnung.
Wie wichtig ist dir Familie?
Meine Eltern sind mir sehr wichtig. Wir sehen uns wöchentlich. Ich telefoniere immer mit ihnen, wenn ich Zweifel habe oder bevor ich eine wichtige Entscheidung treffe. Meine Geschwister sehe ich eigentlich nur an Weihnachten oder so.
Wie wichtig ist dir eine eigene Familie?
Meine Eltern sind meine eigenen Eltern. Ich verstehe die Frage nicht. (Ich wusste, worauf der HR-Mann hinaus will.)
Einen Mann, Kinder?
Oh, Kinder. Einen Mann. Ist das hier relevant?
Ja.
Warum?
Weil nur Mitarbeiter, die ein erfülltes Privatleben führen, bei der Arbeit zufrieden und daher produktiv sind und gesund bleiben.
Ah! Dann ist die Frage: Hast du ein erfülltes Privatleben? Ja, das habe ich.
Aber du hast sicher noch Wünsche, die du dir noch nicht erfüllt hast.
Willst du mich fragen, ob ich Kinder will?
Wenn das zu deinen Wünschen gehört.
Willst du mich fragen, ob ich einen Kinderwunsch habe?
Nein. Aber so wie du deine Karriere planst, wirst du wohl auch dein Privatleben planen?
Willst du wissen, ob ich Kinder kriegen will?
Du weisst, dass ich dich das nicht fragen darf.
Darum fragst du so um den heissen Brei rum.
Nein, verstehe mich nicht falsch. Wir wollen nur wissen, ob du langfristig, auch privat, zufrieden bist.
Ein Privatleben plant man nicht. Ich kann mir mit harter Arbeit Kompetenzen erarbeiten. Ich kann mich in Position bringen, wenn ein interessanter Job vakant wird. Ich kann bei jeder Beförderung, bei jeder Spezialaufgabe zeigen, dass ich der Aufgabe gewachsen bin. Das Resultat zählt. Ich muss hinter meiner Arbeit stehen können. Ich muss am Limit arbeiten können. Ich muss wissen, warum ich abends müde bin.
Eine Beziehung ist keine Arbeit. Ich will jemanden lieben, ich will geliebt werden und ich will entspannen. Ich will nicht an einer Beziehung arbeiten. Wie bescheuert ist denn das? An einer Beziehung arbeiten nur diejenigen, die nicht alleine sein können oder ihr Haus, ihr Ferienhaus und ihre zwei Autos nicht verlieren wollen. Planst du dein Privatleben? Es wäre für mich wichtig zu wissen. Ich möchte wissen, nach welchen Kriterien meine Antworten bewertet werden.
Ich habe die Stelle nicht bekommen. Ich sei noch nicht reif dafür. Ich müsse an meinen Sozialkompetenzen arbeiten. Ich fand einen passenden Kurs, den das Unternehmen anbietet. Dieser wurde mir aber nicht genehmigt oder finanziert.
Nicht jedes Bewerbungsgespräch verläuft so. Aber die meisten Frauen sagten, man habe ihnen viele private Fragen gestellt. Ich glaube nicht, dass es nur subjektive Wahrnehmung ist. Sozusagen, dass Frauen empfindlicher als Männer auf solche Fragen reagieren. Ich höre solche Beispiele seit Jahrzehnten. Ich hingegen, musste nie die Frage beantworten, ob ich alles unter einen Hut bekomme. Nicht einmal, als bei der Mutter meiner älteren Tochter einen Hirntumor entdeckt wurde. Meine Tochter war damals 11 Jahre alt und lebte bei ihrer Mutter. Mein Chef war über die Situation informiert. Auch über den Verlauf der Krankheit. Es ging schnell. Nach zwei Operationen starb sie. Gleichzeitig hatte ich mit meiner jetzigen Partnerin ein Kind bekommen. Die Probleme zu beschreiben, die ich mit meiner Tochter, meiner Freundin, anderen Familienmitglieder und Behörden hatte, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Es war die härteste Zeit, die ich bis jetzt erlebt habe. Gleichzeitig gab es grosse Umstrukturierungen innerhalb des Unternehmens, bei dem ich angestellt war. Obwohl mein Chef und die HR über meine private Situation informiert waren, wurde ich nicht ein einziges mal gefragt, ob ich alles schaffe. Im Gegenteil. Einzig mein Disponent, dessen Frau starb, als seine Kinder etwa das Alter meiner Tochter hatten, fragte mich, ob er mir helfen könne. Und das tat er, indem er mir zum Beispiel weniger Wochenend- und Spätdienste gab.
Ich bin nicht der Ansicht, ein Unternehmen müsse zwingend auf die privaten Bedürfnisse jedes einzelnen eingehen. Mir geht es darum, dass Frauen immer wieder in die Rolle der Hausfrau, die auch noch arbeitet gesteckt wird, die Männer hingegen die Alleinernährer sein soll. Frauen sagen mir regelässig, dass sie sich einfach nicht ernstgenommen fühlen, wenn man sie immer und immer wieder in diese Rollen stecken will. Man würde sie nicht gleich behandeln wie Männern.
Was wäre wenn?
In allen Gesprächen, die ich geführt habe, taucht etwas immer wieder auf: Frauen fühlen sich im Berufsleben oft nicht ernst genommen. Und eine Aussage, welche ich ebenfalls oft gehört habe: Männer hätten Angst, ihre Macht zu verlieren. Ihre Komfortzone. Ihre Privilegien.
Männer müssten sich tatsächlich anstrengen, würden Frauen gleich wie Männer behandelt. Sie hätten nämlich neben Konkurrenten auch Konkurrentinnen, insgesamt also mehr Konkurrenz. Und ein Teil dieser Konkurrenz würde zudem nicht innerhalb den gängigen männlichen Spielregeln agieren.
Frauen brillieren oft mit guten Argumenten, guter Vorbereitung und Konsensfähigkeit. Frauen sagen mir, sie müssten immer besser recherchieren, wenn sie ein Thema vorschlagen wollen. Ein Mann könne am Redaktionstisch einfach mal ein Thema in die Runde werfen. Die Seilschaften würden den Rest erledigen. «Wir Frauen müssen uns oft noch am Sitzungstisch in der versammelten Runde einem Fragekatalog stellen. Spricht ein Mann ein Thema an, ist es schneller zumindest provisorisch auf der Themenliste. Die Vorrecherche, auf die die Frau bereits an der Sitzung geprüft wurde, kann er danach machen. Ich muss viel in meiner Freizeit vorrecherchieren. Sonst kann ich meine Themen nicht durchsetzen.» Eine Redaktionsleiterin einer Zeitung beschrieb es so: «Die Männer sorgen schon vor der Redaktionssitzung dafür, das ihr Vorschlag an der Sitzung durchkommt. Sie plaudern schon vorher mit Kollegen. Am Redaktionstisch setzten sie sich dann gegenseitig füreinander ein. Frauen kommen mit Fakten an den Tisch. Männer mit Kollegen.»
In den Redaktionen, auf denen ich die letzten drei Jahre gearbeitet habe, hatte ich den Eindruck, dass sich diesbezüglich einiges getan hat. Ich denke, es hat auch damit zu tun, dass Frauen dort auch Schlüsselstellen besetzen. Und ich glaube, dass diese Männergruppen tendenziell weniger aktiv waren.
Was hätte es aber konkret im Arbeitsalltag für einen Einfluss, wenn Frauen in allen Redaktionen zu gleichen Teilen in Schlüsselpositionen vertreten wären wie Männer? Müssten die Männer Angst davor haben? Hätten wir total andere News?
Warum braucht es Frauen in Machtpositionen? Warum müssen wir Rücksicht auf die Frauen nehmen? Was wollen Frauen denn noch? Wann hören sie auf zu fordern?
Ich, der Sexist
Rund drei Jahre lang habe ich recherchiert. Zusagen, Absagen, vielleicht ja, oder doch nicht, will schon aber kann nicht. Ich kam nicht darum herum, mich und meine Arbeitsweise zu hinterfragen. Mein Verhalten zu reflektieren. Und? Bin ich frei von Sexismus? Nein! Im Gegenteil. Ich sagte den Frauen dauernd, was sie zu tun hätten. Ich wollte, dass sie ihre Geschichten erzählen. Für ihr Recht kämpfen. Ich sagte ihnen, dass sie mit Schweigen nichts erreichen würden.
Einmal mehr steht ein Mann da, der den Frauen erzählt, was sie zu tun haben. Das ist Sexismus. Ich wusste schon lange, dass ich ein Sexist bin. Nur dachte ich, mein Sexismus richte sich bloss gegen Männer.
Und du? Was für ein Sexist bist du?
Danke!
Kommentare
Ich freue mich über deinen Kommentar.
Weil ich täglich rund 50 Spam-Kommentare bekomme, habe ich die Funktion ausgeschaltet. Versuchen Sie sich nicht anzumelden um zu kommentieren. Schreiben Sie Ihren Kommentar in das Formular und schicken Sie es ab. Ich werde dann den Kommentar – falls erlaubt und / oder erwünscht, on line stellen.
Auch wenn steht, man müsse Email und Name angeben: Es geht auch ohne.
Das Formular finden Sie hier.





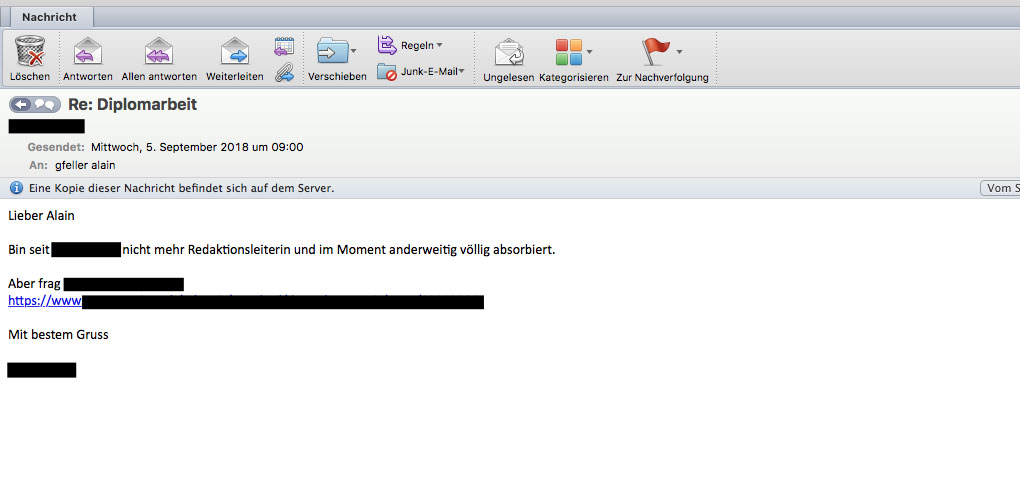




Vielen, vielen Dank! Wir erleben es jeden Tag. Aber irgendwie fühlt man sich trotzdem alleine. Dieser Bericht macht, dass ich mich nicht mehr so alleine fühle. Obwohl ich wusste, dass ich nicht alleine bin.
Frau Bleicher ist eine bewundernswerte Frau!
Latent wusste ich es schon lange. 1‘000x hatte ich ein schlechtes Gewissen. Ich liess Dinge geschehen ohne einzugreifen. Kleine Sachen die man locker wegstecken kann, dachte ich. Aber es ist die Summe die eine Rolle spielt. Jeden Tag einen Kampf führen. Jeden Tag besser sein müssen.
Danke für diesen wertvollen Beiteag. Der übrigens nicht nur für Medienleite ist. Es zeigt Strukturen, die auch bei Versicherungen oder im Verkauf stark präsent sind.
„Das sind keine Almosen“ den Nagel auf den Kopf getroffen!
Was hier fehlt, ist wie Alain Gfeller sozialisiert ist. Wie kommt ein Mann dazu so eine Arbeit zu schreiben? Einzig im „Dank“ ist ein Hinweis zu finden. Aber das sagt nicht genug aus.
Und was auch fehlt ist, ob diese Diplomarbeit bestanden hat oder nicht.
Basil K sagt es richtig: Die strukturellen Problem sind auch in anderen Branchen gleich. Ich werde diese Seite bei uns im Büro allen empfehlen. Ich hoffe, dass viele Frauen und Männer hier etwas lernen.
Frau Bleicher, sie sind meine Heldin!
Es gibt also auch Männer die das Problem bemerken. Es müsste mehr davon geben!!!
Es ist bizarr, erschreckend und traurig wenn man das so liest. Ich erkenne mich in ein paar Situationen. Ich war mir nicht bewusst was ich damit auslöse. Aber trotzdem ist es traurig und erschreckend was passiert. Wir könnten alle unser Verhalten ändern. Aber bis jetzt wisst ich nicht was alles so dranhängt. Sexismus war für mich etwas anderes. Sie müssten diese Sachen in einer grossen Zeitung schreiben und im Fernsehen zeigen. Damit es alle erfahren.